



Tschernitz
Unser
Wappen von
Tschernitz (niedersorbisch
Cersk)
aus der Ortsgemeinde
Tschernitz-Wolfshain
Wolfhain
Wolfshain (niedersorbisch
Śisej)
Bis zur Eingemeindung nach
Tschernitz am 26. Oktober
2003 war Wolfshain eine
eigenständige Gemeinde
Musik
Volksmusik umfasst Volkslieder
und Instrumentalmusikstile, die
nach dem Wortsinn zum
kulturellen Grundbestand eines
Volkes gehören. Stilistisch und
in ihrem Gebrauchswert wird
damit Volksmusik von
Kunstmusik, Kirchenmusik und
Popularmusik unterschieden.
Wurzeln des Ukraine-Krieges
Die ersten Jahrzehnte nach
dem Zweiten Weltkrieg waren
geprägt durch die bipolare
Weltordnung zwischen Ost und
West, die nahezu alle Aspekte
der internationalen
Beziehungen bestimmte.

Tschernitz-Wolfshain-TV
auf der Startseite



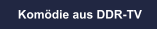







Folge Nr. 52
Empfehlung





«Historische Rede»: Carney trieb Trump am WEF zur Weissglut
Mark Carney hat mit seiner WEF-Rede viel Lob geerntet – und den Unmut von Donald Trump auf sich
gezogen.
Darum gehts
•
Kanadas Premierminister Mark Carney hielt eine viel beachtete Rede am WEF in Davos.
•
Er kritisierte den Bruch der Weltordnung und die Grossmachtkonkurrenz.
•
US-Präsident Donald Trump reagierte scharf. Er warf Carney Undankbarkeit vor.
Der kanadische Premierminister Mark Carney hat mit einer Rede am
Weltwirtschaftsforum in Davos für grosses Aufsehen gesorgt. Er sprach
über den «Bruch der bisherigen Weltordnung», die wachsende
Konkurrenz der Grossmächte und den «Verlust einer regelbasierten
Ordnung».
US-Präsident Donald Trump reagierte scharf und warf Carney
mangelnde Dankbarkeit gegenüber den USA vor. Gleichzeitig erhielt
Carney breite Unterstützung von Politikern und Medien. Der finnische
Präsident Alexander Stubb nannte seine Rede die beste des Treffens.
Einige Beobachter bezeichneten sie gar als «historisch».
«Ära der Grossmachtkonkurrenz»
«Wir werden jeden Tag daran
erinnert, in einer Ära der
Grossmachtkonkurrenz zu leben», sagte Carney in Davos. Er kritisierte, «dass die regelbasierte
Ordnung schwindet. Die Starken können tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was
sie erleiden müssen.»
Der Premierminister rief mittelgrosse Staaten zur Zusammenarbeit auf. Wenn sie sich gegenseitig
ausspielten, um die Gunst der Grossen zu erlangen, könnten sie nur verlieren.
Trump schiesst gegen Kanada
Das Publikum in Davos reagierte mit einer Standing Ovation. Der britische «Guardian» schrieb,
Carney trete als Realist auf, der bereit sei, Trump entgegenzutreten. Die «New York Times»
erklärte, Davos habe den kanadischen Premierminister zu einem Weltstar der Politik gemacht.
«Mark Carney inszeniert sich als Anti-Trump», stellte die «NZZ» fest.
Mark Carney sorgte mit einer Rede am Weltwirtschaftsforum in Davos für internationales Aufsehen und warnte vor
dem Zerfall der bisherigen Weltordnung.




Folge 51












